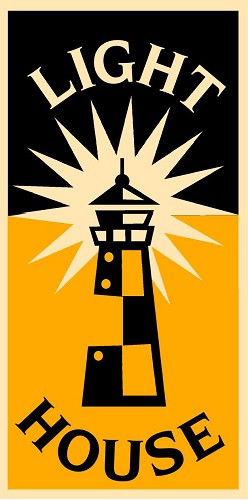|
| |
| Journalistische Texte, Reportagen:
|
FREITAG Nr. 43, 26.10.2007
Michael Schomers
Ein Bier und einmal "ohne"
MALAWI: Im
"Kawale Culture Dancing Club" von Lilongwe gibt es nur Safer Sex
Roter Staub liegt wie Dunst über der Straße, ab und zu fährt ein
Lastwagen durch diesen flirrenden Schleier oder ein Bus hält bei den kleinen
Steinhäusern am Rande der Piste. Freitagmorgen auf dem Markt von Nanjiri,
einem kleinen Dorf etwa 30 Kilometer von Malawis Hauptstadt Lilongwe
entfernt. Zweimal wöchentlich kommen hier mehrere tausend Menschen zusammen.
Marktfrauen und Händler vorzugsweise, die ihre Waren anbieten. Um ein
weitläufiges Areal postiert stehen einfache Häuser mit kleinen Ladenlokalen
im Souterrain, die meisten Händler freilich bieten ihr Sortiment auf
wackeligen Holzgestellen oder in kleinen Hütten an. Viele Marktfrauen sitzen
auch einfach auf dem Boden, haben Obst und Gemüse vor sich ausgebreitet oder
die Tomaten zu kleinen Türmchen aufgestapelt.
Durch die verbleibenden schmalen Gassen drängen die Menschen. Hunderte von
verschiedenen Gerüchen strömen auf den Besucher ein: dort wird in einer
Garküche gebraten, es riecht nach Zwiebeln, Tee, Gewürzen und Staub. Die
Käufer kommen von weit her, bis zu 30 Kilometer weit. In einer Ecke sitzen
zwei alte Frauen und bieten allerhand Hilfsmittel für traditionelle
Heilungen und Kuren feil: Kräuter, Wurzeln, getrocknete Tierfelle.
Kein Sex vor der Ehe
Die 30-jährige Bessie Nkhwazi - eine stämmige Frau, die Haare nach der
neuesten malawischen Mode zu einem Pagenkopf geglättet und mit einem
Haarteil ergänzt, trägt ein knöchellanges schwarzes Kleid. Bevor wir jedoch
den Markt betreten, wickelt sie sich ein gebleichtes Tuch um die Hüften.
"Frauen in Röcken werden eher respektiert", murmelt sie, "gerade hier auf
dem Markt ist das so."
Bessie ist nervös. Heute ist Premiere, es soll das erste Mal sein, dass sie
mit ihrer Safer-Sex-Show ausgerechnet vor diesem Heer von Marktfrauen
auftritt. Aber die gelernte Krankenschwester, die seit ein paar Jahren als
Gesundheitsberaterin bei der Family Planning Association of Malawi
arbeitet, hat sich einer Mission verschrieben: Aufklärung über Sex und
Verhütung, Familienplanung und Aids natürlich.
Deshalb auch gibt es die Theatertruppe vom Youth Life Center, dem
Jugendzentrum in einem der ärmsten Quartiere von Lilongwe. Die jungen Frauen
und Männer haben seit Wochen verschiedene Lieder und Theaterstücke geprobt,
und ein Teil des Repertoires soll nun am Rande dieses Marktes zu sehen sein.
Mittlerweile sammelt sich - animiert durch die Trommeln des Ensembles - eine
beachtliche Menschenmenge, immer wieder von Helfern zurückgedrängt, die
dafür sorgen, dass ein großer Kreis sich öffnet und das Forum für die Szenen
hergibt.
Laut kreischend und klagend rast ein junger Mann über den Platz. Das ist das
Zeichen: die Aufführung hat begonnen. Es wird ein lautes und deftiges Stück,
die Geschichte von einem Vater, der die 15-jährige Tochter an einen weitaus
älteren Mann verheiratet, damit sie der Familie nicht länger auf der Tasche
liegt, aber der Erwählte entpuppt sich als untreuer Lebemann, der bei jedem
Marktbesuch zu den Prostituierten geht und die junge Ehefrau zu allem
Überfluss mit Aids infiziert. Als die Tochter stirbt, hebt das jammervolle
Wehklagen der Eltern an, was aber bei den Zuschauern nur zu höhnischem
Gelächter führt. Denn schließlich - und das ist die Botschaft des
Spektakels, auf die Bessie und ihre Schauspieler hoffen - haben ja alle von
vornherein gewusst, wohin eine solche Heirat führt.
Szenen dicht am Leben der Zuschauer, mehr Agitprop als Kunst, ein saftiges
Bauerntheater, aber die Leute mögen es. Zum Schluss wird ein Lied
herbeigetrommelt und skandiert: "Ihr Mädchen, kümmert euch um eure
Ausbildung! Heiratet nicht zu früh! Kein Sex vor der Ehe!"
Bis vor kurzem galt in Malawi wie in vielen afrikanischen Ländern: Sex hat
man, aber man spricht nicht darüber. "Verhütung und Kondome" blieben für
viele Fremdworte. Die gleiche Sprachlosigkeit galt natürlich dem Thema Aids.
Ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung Malawis sind nach offiziellen Zahlen aus
dem Gesundheitsministerium infiziert. Es gibt Mediziner in Lilongwe, die
davon ausgehen, dass es in Wahrheit erheblich mehr sind. Genaue Zahlen
freilich kennt keiner, denn noch wird in diesem Land kaum systematisch
getestet. Mittlerweile ist die durchschnittliche Lebenserwartung von 45
Jahren (1995) auf gerade einmal 33 (2006) gesunken. Zwangsläufig wird
allenthalben über Aids gesprochen, aber Aufklärung ist schwer.
Die Übertragung des HI-Virus geschieht in der Regel über heterosexuelle
Kontakte. Frauen sind unter den neu Infizierten in der Mehrheit, viele geben
den Virus an ihre Kinder weiter, während der Schwangerschaft und beim
Stillen, und immer noch verhindern die traditionellen Mythen eine wirksame
Prävention. Und das, obwohl inzwischen jede Familie in Malawi mindestens
einen Angehörigen durch die tödliche Immunschwäche verloren hat.
Süßigkeiten nur verpackt
Aber Aids ist und bleibt immer noch bei vielen ein Tabu. Um das zu ändern,
ist Bessie Nkhwazi mit ihrer Theatertruppe unterwegs, wirbt sie mit ihrer
Aufklärungskampagne auf der Straße, in Schulen und Jugendzentren - tritt sie
mit ihren Schauspielern sogar in Bordellen auf. "Nach Kondomen zu fragen,
ist ein Menschenrecht!" heißt es auf einem ihrer Plakate. Bessie ist sicher,
es wird nur über die Frauen gehen: Starke, selbstbewusste und gut
ausgebildete Frauen können ihr Leben selbst bestimmen und etwas verändern.
Abends begleite ich sie bei einem außergewöhnlichen Termin, denn im
Kawale Culture Dancing Club, einem der vielen Bordelle in Lilongwes
Vorstädten, startet in dieser Nacht Bessies Safer Sex & Condom Promotion
Show. Man muss dazu wissen, Bordelle sind hier im südlichen Afrika
zumeist Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ein schlichter Innenhof, von
ein paar Gebäude umrahmt und voller Menschen, dazu dröhnende Musik und Bier.
Die Männer hängen herum, flirten mit den Frauen, trinken und unterhalten
sich. Bevor die Show beginnt, komme ich mit einer der Sexworkerinnen ins
Gespräch. Nicht Prostituierte, sondern "Sexworkerinnen" wollen die jungen
Frauen in diesem Etablissement genannt werden.
Ich spreche mit Brandinah Khulamba, die 18 Jahre alt ist und seit einem Jahr
jeden Abend im Club auf Freier wartet. Nachdem ihre Eltern bei einem
Autounfall ums Leben kamen, wohnte sie zunächst mit ihren Geschwistern bei
einem Onkel. "Ich mag ihn nicht", sagt sie und lässt alles weitere offen.
Schließlich lief sie gemeinsam mit ihrer heute zwölfjährigen Schwester davon
und fand Aufnahme im Club. Für ein paar Kwacha darf sie in einem verlassenen
Haus in der Nähe schlafen, die kleine Schwester lebt in einem Internat. Sie
könne es nicht anders sagen, das Bordell empfinde sie mittlerweile als ihr
Zuhause. Für eine Stadt wie Lilongwe sei dieser Club wirklich etwas
Besonderes, es gäbe nur Safer Sex. Selbstverständlich sei das schwer
durchzusetzen. "Denn Aids hin, Aids her, die meisten Männern mögen das nicht
und sagen. ›Süßigkeiten schmecken auch nicht in der Verpackung‹. Und dann
mieten sie die Frauen und bieten ihnen mehr Geld für ›ohne‹."
Seit Bessie im November 2006 das erste Mal bei den Sexworkerinnen mit ihrer
Safer-Sex-Show unterwegs war, hat sich viel geändert. Heute, glaubt sie,
arbeite keine der Frauen mehr ohne Kondom. Ihr Gemeinschaftsgefühl und
Selbstvertrauen seien enorm gewachsen, und sie hielten zusammen.
Auf der Bühne hat zwischenzeitlich die Show begonnen: nach einem
Tanzwettbewerb wird an übergroßen Modellen demonstriert, wie Kondome benutzt
werden. Die Männer johlen, die Stimmung steigt. Brandinah tanzt mit einem
großen kräftigen Kerl, der bereits ziemlich angetrunken scheint. Immer
wieder zerrt sie ihn auf die Tanzfläche, umgarnt ihn, holt ein weiteres Bier
und trinkt ihm zu. Wenn sie es schafft, ihn zu einer Nummer zu überreden,
und wenn er später nicht zu betrunken ist, kann sie mit 150, vielleicht
sogar 200 Kwacha (ein Euro) rechnen. Ein Kuche Kuche, das
malawische Bier, kostet 50 Kwacha.
Viel bleibt Brandinah von ihren Einkünften nicht. "Meistens habe ich gegen
Ende des Monats gerade einmal tausend Kwacha verdient", erzählt sie. Und -
so klar will mir das an diesem Abend von den Frauen keiner sagen - der
Besitzer des Clubs kassiert vermutlich auch noch mit.
Vor ein paar Wochen hat Bessie im Club eine Fußballmannschaft gegründet.
Dreimal in der Woche trainieren die zwölf Sexarbeiterinnen nun und träumen
davon, in die nächste Klasse aufzusteigen. Über Träume und das, was man
Zukunft nennen könnte, wird unter ihnen viel geredet. Vielleicht ein kleines
"Business" eröffnen oder einen kleinen Laden auf dem Markt betreiben. Auch
Brandinah hat ihren Traum: sie möchte irgendwann wieder zur Schule gehen.
|
FREITAG Nr. 35, 01.09.2006
Michael Schomers
So mancher Traum und kein Erwachen
SWASILAND Eine ganze Generation stirbt an AIDS
Wer kennt schon Swasiland, den Kleinstaat zwischen
Mozambique und Südafrika? Normalerweise taucht Swasiland in Europa nur in
den Boulevardmedien auf, wenn König Mswati III., einer der letzten absoluten
Monarchen Afrikas, für eine seiner elf Ehefrauen teure Limousinen in
Deutschland ordert.
Die Wirklichkeit im Land sieht anders aus. Frühmorgens auf dem Markt in der
Hauptstadt Mbabane. In langer Reihe sitzen Frauen an ihren winzigen Obst-
und Gemüseständen, scherzen und lachen miteinander, an der Bushaltestelle
drängeln sich die Schulkinder. Ungetrübtes Leben jedenfalls auf den ersten
Blick. Aber fast jeder Zweite in Swasiland ist HIV-positiv. Mit 42,6 Prozent
hat man es hier mit der weltweit höchsten Rate an AIDS/HIV- Infizierten zu
tun, die Immunschwäche rafft die Bevölkerungsgruppe der 15- bis 45-Jährigen
dahin. Schon heute fehlen überall Fachkräfte, viele Felder bleiben
unbestellt, da gut die Hälfte der einstigen bäuerlichen Bevölkerung fehlt.
70.000 AIDS-Waisen zählte man 2005, nach UN-Angaben wird diese Zahl in fünf
Jahren auf 120.000 gestiegen sein. Es gibt Orte, in denen kaum noch
Erwachsene leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Swasis liegt bei
gerade einmal 34 Jahren, die niedrigste weltweit.
Spät, zu spät
Sandiné ist gerade 16 Jahre alt. Vor zwei Jahren starben ihre beiden Eltern
innerhalb von sechs Monaten an AIDS. Gemeinsam mit ihren fünf jüngeren
Geschwistern, für die sie jetzt allein verantwortlich ist, lebt sie in
Egaleni, einem kleinen Dorf im Osten des Landes. Nach dem Tod der Eltern
wusste sie vor allem eines: Es gab es keine Verwandten, und es gab auch fast
keine Nachbarn mehr. Zum Glück fand sich Hilfe durch den Ortsvorsteher, den
75jährigen Sekiehl Sipho Mamba, der früher einmal Agrarminister von
Swasiland war. Mit seinen kurzen weißen Haaren sieht er deutlich jünger aus,
wozu auch das um die Hüfte getragene Leopardenfell beitragen mag, das ihn
als traditionellen Heiler und Schamanen ausweist. "Vor drei Jahren rief die
Regierung die Bevölkerung auf, etwas gegen AIDS zu tun", berichtet er. "So
haben wir diese Waisenbetreuung eingerichtet. Ich bin von meinem Amt
zurückgetreten und wieder in das Dorf gegangen, in dem schon mein Großvater
lebte. In unserer Kultur war immer jemand für die Waisen da. Es galt als
selbstverständlich, dass sich die nächsten Angehörigen um zurückgelassene
Kinder kümmerten. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert."
Teilweise versagt das traditionelle Auffangsystem. Nach dem Tod der Eltern
brechen die meisten Waisen die Schule ab, die nicht länger zu bezahlen ist.
Viele Kinder sind durch Verwahrlosung und Missbrauch bedroht, so dass in
Swasiland eine Generation der Verunsicherten und Traumatisierten aufwächst,
die allein schon wegen der entbehrten Ausbildung kaum je in der Lage sein
dürfte, Verantwortung für andere und damit in der Gesellschaft zu
übernehmen.
"Wir bieten den Kindern hier zwei warme Mahlzeiten täglich, außerdem können
sie bei uns zur Schule gehen", erklärt Sipho Mamba sein karitatives Werk.
Mittlerweile betreut er 40 Waisen, die er stolz "meine Kinder" nennt. Noch
sitzen sie beim Unterricht auf dem Boden, bald wird es auch Tische und Bänke
geben, denn seit ein paar Monaten wird Sipho Mamba durch den Verein
Hand in Hand aus
Wiesbaden unterstützt, der den Neubau der Schule finanziert. Er habe den
Unterschied gesehen, meint er, zwischen den Kindern, die verlassen und
vereinsamt blieben, und denen, die jetzt seit zwei Jahren in Egaleni betreut
würden. "Unsere Kinder sind gesünder, vor allem können wir ihnen das Gefühl
vermitteln, wieder eine Zukunft zu haben." Wichtiges Thema in der Schule ist
immer wieder die sexuelle Aufklärung, um offen über AIDS zu sprechen. "Eine
unverzichtbare Voraussetzung, damit sich im Land etwas ändert", glaubt Sipho
Mamba.
Die AIDS-Gefahr wurde in Swasiland lange Zeit geleugnet oder totgeschwiegen.
Erst seit Mitte 2005 gibt es ganzseitige Anzeigen in den Zeitungen oder
Plakatwände an den Straßen. "Ngoba likusasa nelami" (Weil Morgen mir gehört)
ist dort zu lesen. Man sieht auf den Aushängen junge Menschen im goldenen
Licht einer aufgehenden Sonne, denen Sprüche zugeordnet sind: "Ich will
meine Ausbildung zu Ende bringen. Ich denke an meine Zukunft. Sex kann
warten."
Spät, zu spät, sagen viele. Wenn dieses Jahr zu Ende geht, werden wieder
20.000 Menschen an der Infektion mit dem HI-Virus gestorben sein. AIDS lässt
eine Generation sterben, die eigentlich antreten müsste, Ökonomie und
Gesellschaft am Leben zu erhalten.
Es sind der Tradition geschuldete Bräuche, es ist nicht zuletzt der
christliche Glaube, der die Verbreitung von AIDS in Swasiland begünstigt.
Männer dürfen mehrere Frauen haben, der Gebrauch von Kondomen wird
verteufelt, es grassiert der Mythos, sich von Aids heilen zu können, indem
man mit einer Jungfrau schläft.
Verdammt wenig
Das Good Shepherd Hospital am Rand von Mbabane ist eines von nur drei
Krankenhäusern im Lande. Vor den beiden Flachbauten sitzen Frauen und
kochen. Wie überall in Afrika müssen die Verwandten die Versorgung der
Kranken übernehmen. Durch die Tür der Ambulanz, vor der eine lange Schlange
wartet, hört man Lieder. Vielleicht lässt sich dem Leid und der
Hoffnungslosigkeit nur mit einem starken Gemeinschaftsgefühl begegnen. Und
so beten die Pfleger und Schwestern jeden Tag: "Gott möge uns die Kraft
geben, der Seuche AIDS die Stirn zu bieten. Gott möge uns die Kraft geben,
für die Kranken da zu sein."
Seit 25 Jahren arbeitet der indische Arzt Aby Philipp in Swasiland und führt
seit einiger Zeit gemeinsam mit zwei anderen Medizinern dieses Spital,
dessen Patientenzimmer oft überfüllt sind, überall apathische Kranke in
ihren Betten.
"AIDS ist eine große Last für dieses Land. Wir erhalten zwar von der
Regierung Geld, aber das hat noch nie gereicht. Noch nicht einmal, um das
Personal zu bezahlen. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergehen soll.
Die Leute hier sind so krank, und wir haben kaum Medikamente. Wir tun, was
möglich ist, aber das ist so verdammt wenig."
Während die ambulante Versorgung beginnt, beladen zwei Schwestern einen Jeep
mit Medikamenten und Lebensmitteln. Um auch Menschen in entlegenen Gebieten
Swasilands versorgen zu können, hat das Krankenhaus vor ein paar Jahren das
Home Base Care Program begründet. Mpumi Mdlalose, seit 25 Jahren Schwester
im Good Shepherd Hospital, strahlt in ihrer weißen Bluse und dem roten Hut
auf dem Kopf unbändige Energie aus, auch wenn sie wie an diesem Tag die
Siedlungen, in denen Hilfsbedürftige auf sie warten, nur zu Fuß erreichen
kann. "Wir müssen zu den Menschen gehen, weil sie nicht zu uns kommen
können. Wir haben schon viele in ihren Hütten gefunden, die nur noch vor
sich hin vegetierten, weil niemand mehr da war, der ihnen half."
Die meisten Menschen auf dem Land leben noch wie vor Jahrhunderten. Nur
jeder Fünfte von ihnen hat laut einer Umfrage schon einmal in einem Auto
gesessen. Blutdruckmessen, Atmung abhören, Lymphknoten abtasten, die Werte,
das Befinden der Patienten knapp notieren - viel mehr können Helfer wie
Mpumi Mdlalose in der Regel nicht tun. Um so wichtiger ist für die Kranken
der seelische Beistand und das Gefühl, nicht vergessen und aufgegeben zu
sein. Eine Sisyphusarbeit für die Schwestern, denn pro Tag werden in der
Region, die sie als Hilfsdienst bereisen, im Durchschnitt 300 Neuinfektionen
mit dem HI-Virus registriert.
Ein paar Kilometer weiter auf ihrer Tour besucht Mpumi Mdlalose eine kranke
Frau, die auf einer alten Decke im Schatten eines Baumes vor ihrer Hütte
sitzt. Auch hier den Puls fühlen, Blutdruck messen, die Herztöne abhören.
Der wichtigste Augenblick ihres Besuches aber ist der, als sie einen Sack
Mehl und einige Lebensmittel ablädt, die von den Kindern sofort mit großem
Freudengeschrei quittiert werden.
"Unser großes Problem sind die chronischen Krankheiten, die durch HIV
hervorgerufen werden, allen voran Tuberkulose", erzählt Dr. Aby Philipp.
"Wir haben viele Patienten, die wir zunächst zu Hause behandelt haben, die
aber nun alle hierher kommen, in einem schlechteren Zustand als jemals
zuvor. Doch unsere Betten sind voll belegt mit Patienten im letzten
AIDS-Stadium, die nur noch wenige Tage zu leben haben. Vor allem die
Tuberkulose bringt de Menschen um, die Bakterien sind größtenteils resistent
gegen die Medikamente, die wir geben können."
An einer alten Tankstelle in einem Vorort von Mbabane liegt das Büro des
National Emergency Response Council on HIV/AIDS (NERCHA), der die
Anti-AIDS-Kampagnen im Land organisiert. Logo von NERCHA ist der
traditionelle Kriegsspeer der Swasikrieger, abgebildet vor der roten
AIDS-Schleife, ein Kampfsymbol. "Heute wird sehr viel über sexuelles
Verhalten geredet, in den Zeitungen, im Radio und Fernsehen, in den Schulen.
Das verändert das Land", sagt die Koordinatorin Tembi Gama. "Die Frauen
tragen bei alldem die größte Last. Sie kümmern sich um den Haushalt und die
Kinder, bringen das Essen auf den Tisch - und wenn die Frau krank wird oder
im Sterben liegt, hat sie immer noch die Sorge, wie die Kinder nach dem Tod
der Eltern überleben können, wo und wie sie versorgt werden, auch darum
kümmern sich in erster Linie die Frauen".
Der Kampf gegen AIDS ist in Swasiland ein Kampf um das Überleben eines
Volkes. Eltern sterben, Onkel, Tanten und Geschwister, Lehrer, Polizisten,
Bauern, Arbeiter und Angestellte. Täglich werden es mehr. Im nächsten
Jahrzehnt wird mit einem Bevölkerungsverlust von fast einem Drittel
gerechnet.
|
FREITAG, Nr. 46, 7.11.2003
Michael SchomersVerriegeltes Land
PALÄSTINA:
WO DAS LEBEN IN EIN DIESSEITS UND JENSEITS ZERFÄLLT
Palästinenser vor und hinter dem "Zaun"
Israels Generalstabschef Jaalon hat Premier Sharon öffentlich
kritisiert und vor einer Katastrophe in den Palästinenser-Gebieten gewarnt,
die durch das harte Vorgehen der Armee ausgelöst werde. Der General bezog
sich unter anderem auf die extrem beschränkte Bewegungsfreiheit, die sich
inzwischen für 130.000 Palästinenser durch den Verlauf des sogenannten
"Sicherheitszaunes" ergibt. Während der im Oktober begonnenen Olivenernte
können dadurch Tausende von Bauern nur unter ständigen Schikanen ihre
Plantagen erreichen.
Es stehen einige Männer hinter dem vier Meter hohen Metallzaun, vor ihnen
eine ganze Reihe von Obstkisten, abgedeckt mit Plastikplanen und Tüchern. Im
Maschendraht der elektronisch gesicherten Absperrung davor sind Stromkabel
sichtbar, und auf dem gelb gestrichenen Eisentor signalisiert eine weiße
Hand auf rotem Grund "Halt" - das Tor selbst ist mit einer dicken Eisenkette
und einem massivem Schloss verriegelt. Neben der Straße sind
Stacheldrahtrollen gespannt, darin ein rotes Schild: "Lebensgefahr! Jeder,
der den Zaun passiert oder zerstört, riskiert sein Leben."
Keine leere Drohung, hier weiß jeder: die israelischen Soldaten fackeln
nicht lange, sondern schießen sofort, auch an diesem agricultur gate,
das Palästinenser aus der Westbank passieren müssen, wollen sie ihre Felder
jenseits des Zauns erreichen.
Seit vier Stunden schon warten die Bauern aus Falamiya darauf, dass die
Israelis sie wieder in ihr Dorf lassen, aber es tut sich absolut nichts. Sie
haben Äpfel geerntet, die sie nun mühsam zurückschleppen. Die
Demarkationslinie am Tor darf nur überschritten, nicht überfahren werden -
Traktoren und Autos sind verboten, Menschen und Tier erlaubt. Auf der
anderen Seite sitzen ebenfalls Wartende auf leeren Kisten. Wann die Soldaten
kommen, weiß keiner. Offiziell heißt es zwar, das Tor sei zweimal am Tag
passierbar, aber die Realität sieht anders aus. "Sie geben keine Zeit an,
man muss einfach warten. Außerdem, selbst wenn es geöffnet wird, kann keiner
sicher sein, dass er hindurch darf. Manchmal lassen sie uns ewig warten",
erzählen die Bauern, "ein anderes Mal heißt es plötzlich: es darf keiner
passieren, der jünger ist als 45. Es kommt auch vor, dass sie uns die
Passierscheine einfach abnehmen, alles Willkür." Manchmal müssen sich die
Bauern nur für zwei oder drei Stunden um ihre Felder kümmern, aber mit dem
Hin- und Rückweg kann das vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang dauern.
Alte Bäume
Seit fast einem Jahr nun schon zieht sich eine bis zu hundert Meter breite
Schneise durch das Westjordanland, auf der einen Seite flankiert von einem
Graben und einer Staubstraße, auf der anderen von einer zusätzlichen, teils
neuen Asphalttrasse für die Patrouillen der Israelis. Etwa 200 Kilometer des
geplanten "Sicherheitszaunes", der die Autonomiegebiete von Israel abtrennt,
sind inzwischen gebaut, größtenteils verläuft dieses Bollwerk nicht auf der
green line - der Grenze des seit 1967 besetzten Westjordanlandes -,
es wird damit auch Landnahme betrieben, schiebt sich der Schutzwall doch
fast überall nach Osten in palästinensisches Gebiet hinein.
In Jerusalem oder Bethlehem geht der "Zaun" in eine stellenweise bis zu neun
Meter hohe Betonmauer über. Die 40.000 Einwohner-Stadt Qalqiliya hält ein
solcher Zementwall, der allenthalben "die Berliner Mauer genannt wird,
völlig umklammert. Zwischenzeitlich 130.000 Palästinenser werden durch diese
"Schutzmaßnahmen" zu einer Existenz in der Enklave gezwungen, sie wohnen im
Osten des "Zauns", ihr Farmland aber bestellen sie westlich davon.
Im Fall der Obstbauern von Falamiya trifft das auf 45 Prozent der
landwirtschaftlichen Flächen zu. 1992 wurden für den Ort mit französischem
Geld zwei Wasserspeicher angelegt, nun aber hat eine der Leitungen den Bau
des Schutzwalls nicht überlebt, so dass für Falamiya ein Teil der
Wasserzufuhr - nicht zuletzt für die Bewässerung der Felder und Olivenhaine
- unterbrochen ist. Um das zu verhindern, hatten viele Bauern mit den
Israelis wieder und wieder verhandelt, um die Anlage des Zauns lediglich 50
Meter weiter nach Westen zu schieben. Doch vergebens, jetzt trocknet das
Land langsam aus. Vermutlich ist das beabsichtigt, da nach israelischem
Gesetz Agrarland, das drei Jahre lang nicht bebaut wird, an den Staat
zurückfällt.
Die 25 Hektar mit den Jahrhunderte alten Olivenbäumen von Rasheed Abu Taher
lagen genau dort, wo heute die Landschaft um Falamiya in ein Diesseits und
Jenseits zerfällt. Ob er schon einmal überlegt habe, von hier wegzugehen?
"Mein Vater ist hier geboren und hier gestorben, auch sein Vater und der
Vater seines Vaters - es ist unser Land seit Menschengedenken. Allah sei
Dank, dass sie nicht erleben, was jetzt geschieht." Rasheed dreht sich
abrupt herum und starrt eine Weile stumm zur Moschee in der Mitte des
Dorfes. "Wovon sollen wir jetzt noch leben?" Er habe acht Kinder und seine
alte Mutter zu versorgen und jetzt schon kein Geld mehr, eine weiterführende
Schule für die beiden ältesten Töchter zu bezahlen.
Kurzer Prozess
Ein gleiches Schicksal teilen die Bauern von Anin. Den etwa 2.500 Bewohnern
des Ortes ist es seit neuestem verwehrt, in das nahe gelegene Städtchen Um
al Fahim zu kommen - vor einem Jahr noch ihr Markt, ihr Kontakt zur Welt,
der Arbeitsplatz für mehr als hundert Männer aus ihrem Ort, die höhere
Schule, ihr Ziel bei Verwandtenbesuchen, ihre Gewissheit, im Falle des Falls
würde ein Arzt aus dem Gesundheitszentrum von Um al Fahim eintreffen ...
Rabah Jassin, Gemeinderatsvorsitzender von Anin und Sprecher eines der
zahlreichen Komitees gegen den Zaun, kann seine Tochter nicht mehr
besuchen, die in Um al Fahim verheiratet ist. "Man hat mit uns kurzen
Prozesse gemacht", sagt er, "und vom Leben einfach abgeschnitten, das ist
alles."
Das kleine Haus in der Ortsmitte von Anin beherbergt im Erdgeschoss nur
einen Raum mit einem Tisch, vier Stühlen und einem Kühlschrank, in der Ecke
liegt eine Matratze, bespannt mit einer geblümten Decke. Darauf sitzt Janeer
Hamdan, eine alte Frau mit weißem Kopftuch, eine Gebetskette fließt durch
ihre Hand. 26 Enkelkinder, erzählt sie stolz, und die werden natürlich alle
gerufen, ihre große Familie hat Haus und Land eingebüßt, zwölf Hektar,
dieses kleine Domizil ist geblieben. Machmud Asa´d, der älteste Sohn von
Janeer Hamdan, lebt von der geringen Unterstützung durch die
Hilfsorganisationen. Vor dem Bau des Zauns hat er als Maurer in Um al Fahim
gearbeitet. Als er einmal die Ausgangssperre übertrat, wurde er von den
Israelis verhaftet und ihm dabei ein Bein gebrochen. Seither kann Machmud
Asa´d auf kein Baugerüst mehr steigen. Über eine Zukunft weiß er nichts. "Im
Augenblick ist wichtig, dass ich die Kindern irgendwie versorgen kann."
Special permit
Etwa 20 Meter vom agricultur gate in der Nähe von Anin steht ein
Esel, die Packtaschen zu beiden Seiten des Sattels prall gefüllt, obenauf
eine Plastiktüte mit Zwiebeln. Die Soldaten auf der anderen Seite sehen
martialisch aus, tragen Maschinenpistolen und Funkgeräte, zwei Militärjeeps
stehen daneben. Seit einer halben Stunde versucht Ibraim Shahija Shachir mit
seinem Esel passieren zu dürfen. Heute morgen ist er ins Dorf geritten, um
Lebensmittel zu kaufen. Nun will er zurück, natürlich hat der Pendler
zwischen den Welten eine Genehmigung, aber die Soldaten interessiert das
wenig. Nein, teilen sie ihm endlich mit, heute könne er nicht mehr durch, er
solle es morgen wieder versuchen. Ibraim blickt die Posten verstört an,
winkt mit seiner "special permit", zeigt auf die Satteltaschen, wartet stur
und wartet noch einen Augenblick und resigniert schließlich, "Was soll ich
machen, ich versuche es morgen wieder", murmelt er und reitet davon.
Yehezkel Lein aus Israel und die Amerikanerin Rachel Greenspahn arbeiten für
B´Tselem, die Menschenrechtsorganisation Israeli Information Center for
Human Rights in the occupied territories, die auch vom deutschen
Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) in Bonn unterstützt wird. Sie
durchreisen seit Jahren die besetzten Gebieten. "Schon ohne
Sicherheitszaun", meint Yehezkel Lein, "lebten viele Palästinenser wie im
Gefängnis." Es beginnt immer mit dem Bau von israelischen Siedlungen, die
den Palästinensern wie eine Gräte im Hals stecken. Die Bauern verlieren ihre
Felder oder können sie nicht mehr erreichen, denn die Straßen zu neuen
Siedler-Camps, die sogenannten by-pass roads, dürfen Palästinenser nicht
benutzen. Dadurch werden viele Dörfer von der einzigen Zugangsstraße einfach
abgeschnitten. Seit drei Jahren trifft das auch für Harith zu, den Ort neben
der umstrittenen Siedlung Ariel. Hinter dem aufgeschütteten Wall aus Erde
und Steinen verrosten und verrotten seither etwa 20 Autos, die in Harith für
immer ihren letzten Rastplatz gefunden haben. Aus der Gegenrichtung kann
ebenfalls kein Transporter oder Krankenwagen mehr die Gemeinde anfahren,
denn das Umfeld der israelischen Siedlung ist wie üblich zum militärischen
Sperrgebiet erklärt worden.
So müssen die Bauern, um in ihre Olivenhaine zu gelangen, die eigentlich in
Rufweite von Harith liegen, einen Umweg von 20 Kilometern in Kauf nehmen,
und das zu Fuß. Selbst wenn sie einen Traktor hätten, sie könnten damit das
Dorf nicht verlassen, eine by-pass road dürfte damit nicht befahren werden.
Ein System der Apartheid.
Im Oktober hat die Olivenernte begonnen. Die Bauern im Westjordanland
fürchten militante Siedler, die schon mehrfach versucht haben, die Ernte zu
vernichten und Olivenbäume in Brand zu stecken, und sie haben Angst vor der
Willkür der Soldaten. Viele übernachten deshalb in ihren Olivenhainen, auch
wenn es nachts schon empfindlich kalt ist.
|
|
DER KAMERAMANN, 5/2003
Michael Schomers:
„Kap
Hoorn – Drehreise ans Ende der Welt“
Eine Reise ans Ende der Welt
stand uns bevor, als wir mit den Drehvorbereitungen für unseren Film
begannen. „Kap Hoorn, Reise ans Ende der Welt“, ein 60-Minuten Film für den
ARTE-Themenabend „Kap Hoorn“ im Auftrag des NDR. Schon die
Drehvorbereitungen zeigten, daß es um keinen alltäglichen Dreh ging, denn
die Südspitze Südamerikas ist eine außergewöhnliche und abenteuerliche Ecke
dieser Welt. Durch die Magellanstraße
vom Festland getrennt, liegt Feuerland, das Argentinien und Chile unter sich
aufgeteilt haben. Ein sturmumtobter Irrgarten aus Bergen, Gletschern,
Inseln, Fjorden und Kanälen. Auf einer Fläche etwa so groß wie Irland leben
ca. 150.000 Menschen, 500.000 Pinguine und 2 Millionen Schafe. Eine rauhe
Welt mit viel Wind und Wasser.
Wir, Lighthouse Film &
Medienproduktion in Köln, sind eine kleine Familienfirma, ich produziere
seit zwanzig Jahren Dokumentationen und Reportagen für Öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten und habe fast auf allen Kontinenten gearbeitet, nur ins
südliche Südamerika hatte es mich bisher nicht verschlagen. Eine große
Herausforderung für das ganze Team, bestehend aus Wolfram Engelhard
(Co-Autor, der gerade ein Buch über die Kap Horniers, die letzten Seeleute,
die auf frachttragenden Segelschiffen Kap Hoorn umrundet haben,
veröffentlicht hatte), mein Bruder Martin Schomers (Kamera) und mein Sohn Nils
Schomers (Ton) und ich, Michael Schomers (Autor, Regisseur und Produzent).
Während der Drehreise begleitete uns unsere Aufnahmeleiterin Claudia Jordan,
eine Deutsch-Chilenin, die lange in Deutschland gelebt hat und eine
hervorragende Arbeit geleistet hat.
Ziemliches Pech hatten wir mit der Drehvorbereitung. Über einen befreundeten
Kameramann bekam ich Kontakt mit zwei Deutsch-Chilenen, die sich anboten,
die Drehvorbereitungen zu übernehmen. Leider verließ ich mich ungeprüft auf
die Empfehlung des Kollegen. Eine ziemliche Katastrophe, denn ihre Arbeit
beschränkte sich auf die eines mittleren Reisebüros, d.h. sie buchten
Hotels, Flüge und Schiffspassagen, mehr aber auch nicht. Daß zu einer
professionellen Drehvorbereitung vor allem die Planung und Organisation der
Dreharbeiten gehört, (d.h. Planung der Dreharbeiten, Vorschläge für Drehorte,
Suche nach Protagonisten, Drehgenehmigungen, etc.) davon hatten sie keine
Ahnung – und das konnten sie auch nicht. Zum Glück aber hatten wir Claudia,
unsere nette und hervorragende Aufnahmeleiterin und Dolmetscherin, die
vieles vor Ort dann doch noch rettete. Klar war von Anfang an, daß wir auf
16:9 drehen wollten.
Unsere Ausrüstung: IKEGAMI HC 400 W, Weitwinkeloptik Fujinon 4,8 X 10 (eine
Super Optik, die wir – bis auf einige wenige Ausnahmen permanent eingesetzt
haben. Da klar war, daß die Dreharbeiten zu 98 % im Freien stattfinden
würden, hatten wir nur ein Akku-Kameralicht mit, das aber völlig ausreichte.
Ansonsten Standardequipment, allerdings mit einem wunderbaren
Schoeps-Richtmikro. Erste Station unserer Drehreise sind Santiago und
Valparaiso, dort nehmen wir an der Flaggenparade und dem Gedenkgottesdienst
der Kap Horniers teil, die sich dort zum letzten Mal in Chile trafen.
Natürlich hatten wir den Dreh monatelang vorher mit den Kap Horniers
verabredet. Soweit, so gut, vor Ort aber gab es plötzlich leider
Schwierigkeiten mit einem deutschen „Kollegen“, der meinte, sich die
„Welt-Exklusivrechte“ an dem Thema gesichert zu haben und uns alle möglichen
Steine in den Weg legte. Eine Unsitte, die leider immer mehr um sich greift.
Da meinen manche, daß sie durch einen mehr oder weniger großen Geldbetrag
alle anderen Kollegen von der Berichterstattung und Anwesenheit ausschließen
zu können. (Zudem der „Kollege“ sein sogenanntes „Exklusiv“-Material bereits
vorher dem NDR angeboten hatte, dort aber auf Ablehnung gestoßen war,
trotzdem aber in Chile mit zwei kleinen DV-Kameras herumlief und behauptete,
im Auftrag des deutschen Fernsehens zu drehen.) Uns brachte das zwar ein
paar Probleme, aber da uns das Treffen eh nur als ein kleiner Nebenaspekt
unseres Films interessierte, war es nicht tragisch. Aber wir haben uns schon
über die grobe Unkollegialität geärgert, mit der hier auf Kosten anderer
agiert wurde.
Wir wollen die Südspitze Südamerikas erkunden, d.h. vor allem Feuerland,
außerdem mit einem Segelboot Kap Hoorn umrunden, das größte Abenteuer
unserer Reise, denn keiner von uns hat Segelerfahrung. Ausgangspunkt unserer
fünftägigen Segeltour um Kap Hoorn ist Puerto Williams, ein kleiner Ort auf
der Insel Navarino. Als wir mit unseren 200 Kilo Gepäck im Hafen ankommen,
gibt es die erste Überraschung, denn unser Segelschiff, die „Unicornio“ ,
ist doch erheblich kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Ein mulmiges
Gefühl mit dieser „Nußschale“ von nur 12 Metern Länge ums Kap Hoorn zu
segeln. Vor allem aber: kein Platz für unser Gepäck, denn pro Person sind
nur 20 Kilo vorgesehen. Also: alles umpacken, Beschränkung auf das
Allernötigste. Übrigens: im Laufe der Segeltour haben uns mit dem etwas
älteren Ambiente und dem rauhen Charme der „Unicornio“ durchaus
angefreundet.
Die größte Überraschung aber: an Bord gibt es keine Möglichkeit, die Akkus
zu laden, denn es gibt keine 220 Volt! Wie lange reichen die Akkus?
Wir haben 16 Akkus mit: zehn blaue Lithium-Ionen-Akkus und sechs grüne
herkömmliche, aber ähnlich leistungsstarke Nickel-Cadmium-Akkus. Dazu noch
zwei Akkugurte. Das müßte eigentlich ein paar Tage reichen. Und es klappt
auch, obwohl wir nur einmal auf der Insel Lennox die Möglichkeit hatten,
zwischendurch einmal ein paar Akkus für einige Stunden aufzuladen.
Die gesamte Infrastruktur in Feuerland ist für eine Drehreise problematisch,
denn es gibt nur wenige reguläre Verkehrsverbindungen. Das bedeutet: der
Transport mit Schiff, Auto oder Flugzeug, alles muß vorher organisiert
werden. Und das ist alles ziemlich teuer und natürlich zeitaufwendig. Dazu
kommt, daß die Handys nur eingeschränkt, d.h. in der Nähe von menschlichen
Siedlungen funktionieren und da waren wir eben ziemlich selten. Fünf Tage
dauert unsere Segeltour ums Kap Hoorn. Der Dreh an Bord ist nur mit
Schulterkamera möglich, weil das Stativ in der Enge des Schiffes nirgendwo
Platz gehabt hätte. Also muß sich Martin, unser Kameramann, bei hohem Seegang
mit der Kamera irgendwo einklemmen, um Halt zu suchen. Problematisch ist das
Spritzwasser auf der Optik, besonders wegen des Salzes, das getrocknete Salz
verkrustet und wirkt beim Putzen mit dem Leder wie Schmirgel.
Noch ein paar Anmerkungen unseres Kameramanns: „Wir
waren im November, d.h. im südamerikanischen Frühling unterwegs. Das Wetter
an der Südspitze Südamerikas ist äußerst unbeständig. Immer wieder gibt es
Regenschauer, ein paarmal erlebten wir sogar Schneestürme. Regenschutz ist
also obligatorisch. Nur, wenn man ihn unter der Kamera mit den Klettbändern
verschließt (wie vorgesehen) rutscht die Kamera leicht von der Schulter,
weil auch die Goretex–Regenjacke sehr rutschig ist. Martin flog einmal bei
relativ geringem Wellengang die Kamera fast von der Schulter und er hätte
sich fast das Handgelenk gebrochen. Der Steadybag-Sack hat sich hervorragend
bewährt. Nur: wie transportieren? Hängt man ihn sich über die Schulter,
rutscht das ganze nach zwei Schritten runter. Rechte Schulter: Kamera, linke
Schulter: Steadybag: keine Chance. Hier fehlt ein vernünftiger Rutschschutz
aus Gummi. Nächstes Problem: Der Weißabgleichschalter an der Kamera (A, B,
Preset): Hat schon mal jemand der Kameradesigner bemerkt, daß man leicht
unbemerkt an den Schalter kommen kann und sich so seinen Weißabgleich
versaut? Wenn man zum Beispiel die Kamera mit dem dafür vorgesehenen
Schultergurt über die Schulter hängt, bei stetigem Nieselregen, also mit
doppeltem Regenschutz und Plastiktüte über der Optik (natürlich nur für den
Weg!) einen Berg erklimmt, um einen guten Blick auf einen Gletscher zu
bekommen... Das ist mir dann noch mal ein zweites Mal auf der Insel Lennox
passiert, ohne Regenschutz, beim Transport in der Hand, irgendwie. Danach
habe ich die Schalter alle abgeklebt, aber erstens kommt man so nicht mehr
dran, zweitens traut man der Anzeige im Sucher doch nicht so richtig und
wirft gerne noch mal einen Blick drauf... also: Lassoband ab, Lassoband
drauf usw. Sehr nervig.
Irgendwann hatte ich die Kamera dann komplett mit Lassoband zugeklebt: die
besagten Weißabgleichschalter, überhaupt die ganze Schalterreihe, die runden
Drehknöpfe für den Suchermonitor (sollte man bei der Ikegami sowieso immer
machen, denn die verstellen sich fast von alleine). Ich kann mir nicht
vorstellen, daß einer der Kameradesigner jemals einen Praxistest
durchgeführt hat mit diesem Suchermonitor: einmal nur die Kamera auf die
Schulter nehmen, wieder runternehmen, mit der Kamera in der Hand ein paar
Schritte gehen und sie dann wieder auf die Schulter setzen – und alles ist
verstellt!).“
Als wir am Ende unserer Drehreise noch im Norden Chiles in der
Atacamawüste drehen, haben wir auch den kompletten Einzugsschacht des
Rekorderteils und alle Ritzen und Spalten abgeklebt, denn der äußerst feine
Wüstensandstaub dringt durch den ständigen Wind überall ein. In dieser
Wüste, eine der trockensten der Welt, wurde Salpeter abgebaut, das die
Segelschiffe hier abholten und – rund ums Kap Hoorn – nach Europa
transportierten, weil man es als Dünger und zur Produktion von Schießpulver
benötigte. Außerdem wurde hier Guano abgebaut, Jahrhunderte abgelagerter
Vogeldreck. Für die Kamera war der feine Guanostaub, der bei jedem Schritt
aufgewirbelt wird, noch gefährlicher als der Wüstensand. Die Optik kratzt,
die Augenlider sind verklebt, zwischen den Zähnen knirscht es. Und
irgendwann ist es beim Kassettenwechseln dann doch passiert: Staub im
Rekorder! Warnmeldung, Drehabbruch, zurück ins Hotel, Kamera entstauben.
Gott sei dank, nach ausgiebiger Reinigung ist dann doch alles wieder in
Ordnung. Die Folgen: ein ganzer Drehtag Ausfall wegen der Fahrerei! Und das
hatte gleichzeitig zur Folge, daß wir unseren Rückflug um einen Tag
verschieben mußten. Zum Glück hatten wir eine Negativversicherung.
Auf unserer Reise besuchen wir große und kleine Estanzias auf der wilden
Halbinsel Mitre, Fischerdörfer und lernen viele interessante Menschen
kennen, zum Beispiel Miguel Lechmann, der seit fünf Jahren in einer
einsamen Bucht an der Atlantikküste lebt, den Bäcker Emilio, dessen Bäckerei
jährlich 300.000 Besucher hat, weil es der einzige Stop auf einer Strecke
von 500 Kilometern ist, den Sänger El Negro und viele andere. In Puerto
Williams besuchen wir den Radiosender Jemmy Button, ein paar junge Leute,
die rund um die Uhr Programm senden und live über unseren Besuch im Radio
berichten. Danach kennt uns im Ort jeder. Die Insel Lennox ist militärisches
Sperrgebiet und wir dürfen sie nur mit Sondergenehmigung betreten.
Die einzigen Bewohner der Insel sind
der chilenische Marine-Unteroffizier Pedro Castro und seine Frau Gabriella
mit den beiden Kindern Nathalia und Ricardo, die sich über unseren Besuch
sehr freuen. Denn hier am Ende der Welt schaut selten einer vorbei, nur alle
zwei Monate kommt das Versorgungsschiff der Marine. Aber nach ein paar
Stunden hieß es wieder Abschied nehmen. Es kann Wochen dauern, bis der
nächste Besuch kommt. Ein
Thema, das immer mal wieder große Probleme gibt: Drehkassetten und Fliegen:
Wir nehmen die Drehkassetten immer als Handgepäck mit in den Flieger und
lassen sie beim Einchecken nicht durchleuchten. Es wird uns zwar immer
versichert, daß nichts passiert, andererseits gibt kein Flughafen der Welt
eine Garantie darauf geschweige denn Schadenersatz, falls doch mal ein
Durchleuchtungsgerät nicht ganz in Ordnung sein sollte und vielleicht zuviel
Röntgenstrahlung abgibt, so daß das magnetisierte Bandmaterial Schäden
abbekommt. Das klappt normalerweise relativ problemlos: die Sicherheitsleute
öffnen jede Kassettenhülle per Hand, rappeln ein bißchen an der Kassette und
dann dürfen wir die Kassetten mit in den Flieger nehmen. Manchmal wird noch
ein Sprengstofftest gemacht (mit einem speziellen Staubsauger werden die
Kassetten oder die Kamera abgesaugt und dann der Staub in einer Maschine auf
Sprengstoffpartikel untersucht - ich frage mich immer, was passiert wohl,
wenn irgendwer, der die Kamera vor uns ausgeliehen hatte, irgendwie mit
Sprengstoff in Berührung gekommen ist, ob dann die Kamera vorsorglich sofort
in die Luft gejagt wird?) Die Kamera ist sowieso immer Handgepäck, immer mit
mindestens einem Akku versehen und einer Leerkassette, weil man manchmal
beim Check die Kamera einschalten muß und überhaupt. Meistens klappt also
alles relativ problemlos, besonders an großen Flugplätzen, wo öfters
Kamerateams abfliegen.
Probleme hatten wir in
Punta Arenas,
als wir mit großem Flieger aus Santiago ankamen und mit einem gecharterten
kleineren Flugzeug weiterflogen. Das gesamte Gepäck mit Equipment wurde
direkt umgeladen in andere Flugzeug, wir mußten dann aber mit unserem
Handgepäck ins Flughafengebäude, um die Tickets für den Weiterflug zu holen
o.ä. – natürlich mitsamt Handgepäck (inkl. Kamera und gedrehte Kassetten).
Plötzlich nochmals Sicherheitscheck und Durchleuchten. Der Beamte war total
überfordert, als wir ihm unsere Kassetten in die Hand drückten: noch nie
gesehen! Es folgte eine Riesendiskussion mit Anbrüllen und allem, was
dazugehört. Erfolg: einer der Hilfsbeamten rannte mit unseren Kassetten zum
Piloten des kleinen Flugzeugs, das uns um Kap Hoorn fliegen sollte. Der
guckte sich kurz die Kassetten an, sagte ok. und legte sie zu dem anderen -
nicht durchleuchteten - Gepäck.
Gravierender war die Sache allerdings in Madrid:
Bei unserem halbstündigen Zwischenstop mußten wir die Maschine verlassen,
damit sie kurz gereinigt werden konnte. Natürlich nahmen wir unser
Handgepäck und damit auch die Drehkassetten mit. Obwohl wir nur aus dem
Flugzeug raus in den kleinen, 30 Meter entfernten Warteraum gingen und dann
wieder ins Flugzeug zurück sollten, gab es plötzlich– aus welchem Grund auch
immer – einen Sicherheitscheck d.h. Durchleuchtung. Die vier Polizisten
ließen nicht mit sich reden. Es gab eine lautstarke und heftige
Auseinandersetzung, die Polizisten waren äußerst grob und unhöflich,
weigerten sich, einen höheren Offizier zu holen oder wenigstens jemanden,
der Englisch spricht. Schließlich wurden wir unter Androhung körperlicher
Gewalt mit vorgehaltener Waffe gezwungen, alle Drehkassetten durchleuchten
zu lassen. Zum Glück ist nichts passiert, aber wäre eigentlich wenn? Noch
ein Wort zur „Unterstützung“ durch die chilenische Fluggesellschaft
LAN-Chile, deren Vertreter während dieser Auseinandersetzung daneben stand,
das Spektakel beobachtete und uns (seinen Fluggästen!) in keiner Weise
behilflich war. Er weigerte sich sogar, jemanden von der Flughafenleitung
oder die Vorgesetzten der Polizisten zu holen. Aber eigentlich wunderte uns
das nicht sehr, denn LAN-Chile war insgesamt nicht sehr hilfreich. Zwar bot
man uns Tickets zum Reisebüro-Preis an, aber wir bekamen kein zusätzliches
Übergepäck und man bestand sogar darauf, daß pro Passagier nur zwei
Gepäckstücke transportiert werden würden. Eine völlig absurde Regelung, denn
wie sollen wir das Equipment und das persönliche Gepäck für vier Personen
bei einer fünfwöchigen Drehreise in die unterschiedlichsten Klimazonen
(Regen, Schnee, Nässe) auf vier mal zwei Stücke verteilen.
Und LAN-Chile sicherte uns noch nicht einmal verbindlich zu, daß wir unser
Kamera mit ins Flugzeug nehmen dürften, denn das Handgepäck, so bekamen wir
nur lapidar zu hören, sei alleine Sache des Kapitäns. Die Folge: bei jedem
Einchecken gab es ellenlange Diskussionen und Ärger. Schließlich setzten wir
überall unser Mehrgepäck durch (das Gewicht stimmte einigermaßen, nur hatten
wir natürlich zu viele Gepäckstücke), aber es hat viel Nerven gekostet.
Letzter Tag unseres Segeltörns. Je näher wir mit unserem Boot „Unicornio“
Kap Hoorn kommen, desto stärker wird der Wind. Am vierten Tag erreicht er
Sturmstärke und wir suchen Zuflucht in einer kleinen Bucht der Insel Hermite,
nur 15 Seemeilen vom Kap entfernt. Mit starken Seilen wird das Boot nach
allen Seiten an Land gesichert. Am nächsten Morgen hat der Sturm etwas
nachgelassen. Wir können endlich wieder Segel setzen. Kurs Kap Hoorn.
Ein großartiges Erlebnis und
Abenteuer. Unser Skipper Julio
umrundet zum 26. Mal das Kap. Wir anderen an Bord sind Neulinge. Gott sei
Dank herrscht Sonnenschein. Ein seltenes Erlebnis, denn 300 Tage im Jahr
gibt es in dieser Region nur Nebel, Schneestürme und Orkane.
Immer wieder erlebten wir in den fünf Wochen extremste Wetterbedingungen:
Regen, Schnee, Nässe, Wellen, Salzwasser, dann der Staub in der Wüste und
die feuchte Schwüle in Santiago de Chile. Unsere Drehreise ans Ende der Welt
war ein großes Abenteuer, ein Dreh, den sicherlich niemand von uns in seinem
Leben vergessen wird. Und - im Großen und Ganzen - hat ja auch alles gut geklappt.
|
| |
|